Dieser Beitrag blickt auf das parlamentarische Frühstück am 04.11.2025 im Deutschen Bundestag zurück, bei dem Abgeordnete, Expert*innen und Angehörige politische Optionen, rechtliche Grenzen und sicherheitsrelevante Konsequenzen hinsichtlich in Nordostsyrien inhaftierter Anhänger des Islamischen Staates (IS) mit Deutschlandbezug diskutierten. Zwischen Gefahrenabwehr, rechtsstaatlicher Verantwortung und gesellschaftlichen Vorbehalten steht Deutschland vor einer komplexen Aufgabe: Rückholung wäre nicht nur ein humanitärer Akt, sondern primär strategisches Element innerer Sicherheit.

Einleitung
Die Auseinandersetzung mit der Situation von in Nordostsyrien inhaftierten IS-Anhängern mit Deutschlandbezug, berührt gleichermaßen sicherheitspolitische rechtsstaatliche und gesellschaftliche Dimensionen. Sie betrifft Fragen staatlicher Verantwortung, internationaler Sicherheit und der Bewahrung rechtsstaatlicher Prinzipien und weist auf persönliche Schicksale und familiäre Belastungen hin. Die Diskussion um die Rückholung inhaftierter IS-Anhänger berührt zwangsläufig auch die normative Frage, inwiefern Personen Unterstützung erfahren sollten, die in ein Konfliktgebiet ausgereist sind, sich dort freiwillig einer terroristischen Organisation angeschlossen und (mutmaßlich) Verbrechen begangen haben. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob diese Personen nicht weiterhin eine große Gefahr darstellen. Diese Perspektiven sind nachvollziehbar und bedürfen der kritischen Abwägung – insbesondere mit Blick auf die Rückholung und Einbindung dieser Personen in Deradikalisierungs- und Reintegrationsmaßnahmen, die öffentlich häufig als unverdiente Begünstigung wahrgenommen werden. Gleichwohl würden die geordnete Rückholung und rechtsstaatliche Aufarbeitung dieser Fälle in erster Linie dem Schutz der öffentlichen Sicherheit dienen und die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats demonstrieren, der Kontrolle, Strafverfolgung und Gefahrenabwehr in Einklang bringt.
Vor diesem Hintergrund fand am 4. November 2025 im Bundestag ein parlamentarisches Frühstück auf Einladung des Vereins Grüner Vogel e.V. und unter Schirmherrschaft von MdB Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen) statt. Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft kamen mit Angehörigen zusammen, um den Umgang mit in Syrien inhaftierten IS-Kämpfern mit Deutschlandbezug aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu diskutieren.
Kontext
Fast ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes befindet sich Syrien in einer unübersichtlichen Übergangsphase, in der rechtliche, humanitäre und sicherheitspolitische Fragen ineinandergreifen. Eine besonders drängende Frage aus deutscher Sicht betrifft Personen, die sich aus Deutschland dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen hatten und teilweise seit 2017 in kurdisch kontrollierten Haftanstalten inhaftiert sind.
Etwa 40 Männer mit Deutschlandbezug befinden sich dort unter prekären Bedingungen in Haft – ohne Zugang zu rechtsstaatlichen Verfahren, anwaltlicher Vertretung oder medizinischer Versorgung. Grüner Vogel e.V. mit seiner Beratungsstelle Leben begleitet seit Jahren Angehörige dieser Männer. Viele der Angehörigen setzen sich seit Jahren für rechtsstaatliche Lösungen und sicherheitsorientierte Rückführungsstrategien ein.
Das parlamentarische Frühstück bot ein parteiübergreifendes Forum zur Diskussion der Herausforderungen, persönliche Schicksale und der sicherheitspolitischen Implikationen dieses Themas.
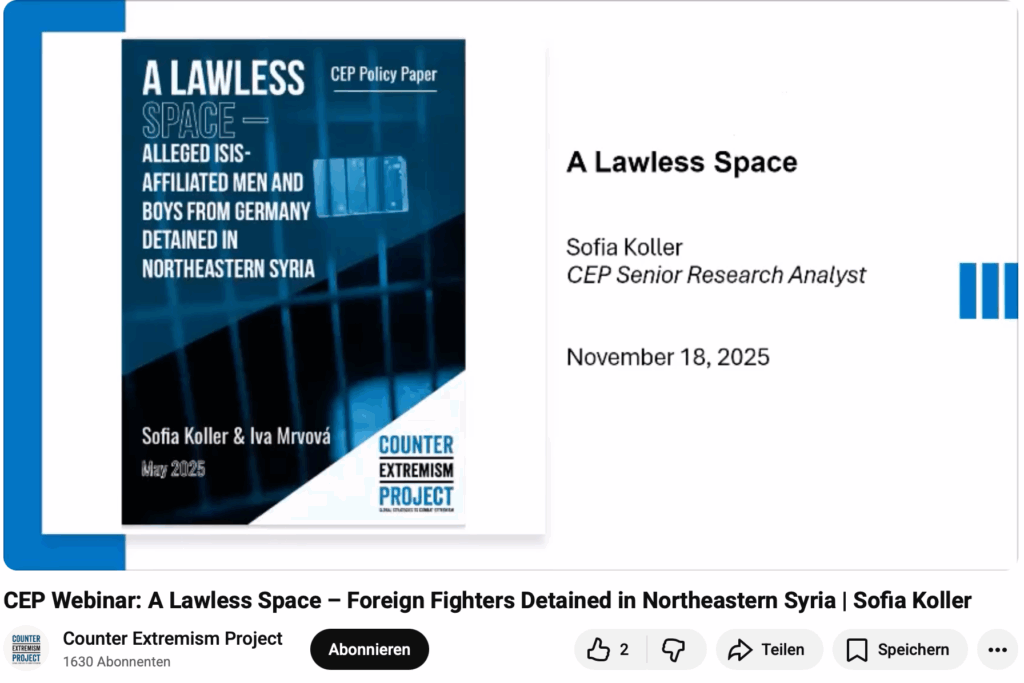
Am 18. November 2025 fand beim Counter Extremism Project ein Webinar zum Policy Paper „A Lawless Space – Alleged ISIS-affiliated Men and Boys from Germany detained in Northeastern Syria“ mit Prof. Ben Saul, Sofia Koller und Iva Mrvovà statt. Die Aufzeichnung und das Papier sind unter folgendem Link abrufbar.
Politische und persönliche Perspektive
MdB Lamya Kaddor, Schirmherrin der Veranstaltung, eröffnete mit einem persönlichen Rückbezug: Als Lehrerin habe sie miterlebt, wie Schüler aus ihrem Umfeld nach Syrien ausgereist seien, um sich dem IS anzuschließen. Diese biografische Erfahrung habe ihre politische Haltung geprägt, die auf Prävention, Aufklärung und Verantwortung setze.
Kaddor berichtete von ihrer erst kurz zuvor beendeten Syrienreise mit Außenminister Wadephul. Sie betonte, dass es in der aktuellen Debatte eine klare Polarisierung zwischen Rückführung und Rückholung gebe: Deutschland diskutiere bislang fast ausschließlich über Rückführungen von in Deutschland straffällig gewordenen Personen in ihre Herkunftsländer, sowie die rechtliche Verantwortung der Länder für Straftäter, nicht aber über Rückholungen und die Übernahme eigener rechtlicher Verantwortung für Deutsche, die sich in Deutschland radikalisiert haben und im Ausland straffällig geworden seien.
Kaddor betonte weiterhin die sicherheitspolitische Brisanz der Situation: Laut dem International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) habe der IS alleine 2024 über 700 Anschläge in Syrien und Irak verübt.[1] In Syrien seien aktuell etwa 9.000 IS-Anhänger, darunter rund 800 Europäer in kurdischem Gewahrsam, darunter etwa 40 Männer mit Deutschlandbezug. Der ungeklärte Verbleib deutscher Häftlinge in Syrien könne neue Radikalisierungsimpulse setzen und perspektivisch ein Sicherheitsrisiko für Europa darstellen.
Sicherheitslage und Präventionsdimension
Der Terrorismusexperte Prof. Peter Neumann (King’s College London) ordnete die aktuelle Debatte in einen sicherheitspolitischen Rahmen ein. Rückkehrende „Foreign Terrorist Fighters“ (FTF) hätten seit 2015 als potenzielle Bedrohung für Europa gegolten. Doch die Erfahrung zeige: Keiner der nach Deutschland zurückgekehrten FTF sei bislang durch Anschläge oder schwere Straftaten aufgefallen.
Neumann führte diesen Erfolg auf die in Deutschland entwickelte Kooperationsstruktur zurück, die ein enges Zusammenspiel von Sicherheitsbehörden, Justiz, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Rückkehrkoordination und zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen ermögliche. Dieses „deutsche Modell“ sei international als Beispiel für eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit, Strafverfolgung und Prävention anerkannt.
Er nannte drei sicherheitsstrategische Argumente für eine geordnete Rückholung:
- Rechtsstaatliche Verantwortung: Nur in Deutschland könne rechtssicher über Schuld und Unschuld entschieden werden.
- Internationale Glaubwürdigkeit: Deutschland müsse zeigen, dass es seine Bürger nicht in rechtlosem Gewahrsam belässt.
- Strategische Sicherheitsprävention: Die instabile Lage in Nordsyrien – einschließlich der geschwächten kurdischen Sicherheitskräfte infolge der verringerten Unterstützung durch die USA – erhöhe das Risiko von Gefängnisausbrüchen und unkontrollierten Rückkehrbewegungen.
Die deutsche Erfahrung zeige exemplarisch, dass innere Sicherheit dort entstehe, wo rechtsstaatliche Strafverfolgung, behördliche Koordination und zivilgesellschaftliche Prävention ineinandergreifen.

Präventionspraxis
Angehörige deutscher IS-Häftlinge berichteten von völliger Isolation, Folter und Ungewissheit über das Schicksal ihrer Söhne, Brüder oder Kinder. Zwei Deutsche seien bereits in Haft verstorben[2]. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) habe seit Jahren keinen Zugang mehr zu den Gefangenen. Weiterhin berichteten die Angehörigen von Erpressungen durch Mitarbeiter des Haftsystems, was ein weiteres Mal dessen Fragilität und Korruptionsanfälligkeit verdeutlicht.
Claudia Dantschke vom Verein Grüner Vogel e.V., der viele der Angehörigen begleitet, bezog sich in ihrem Statement auf das zu diesem Anlass vom Verein Grüner Vogel e.V. herausgegebene Policy Paper „Zwischen Haft und Rückkehr“[3] In diesem wird herausgearbeitet, wie die aktuelle Passivität Deutschlands sicherheitspolitische Risiken erhöht. Der fortgesetzte rechtsfreie Zustand der Haftanstalten schaffe Radikalisierungsräume und Märtyrer-Narrative, die von extremistischen Szenen in Europa gezielt genutzt würden.
Kernaussage der Publikation: „Kontrollierte Rückholung ist keine naive Geste, sondern ein Instrument der inneren Sicherheit.“
Die Publikation empfiehlt:
- Einen gestuften Rückholprozess mit klaren Kriterien (Gesundheitszustand, Tatverdacht, Kooperationsbereitschaft),
- Den Aufbau einer bundesweiten Rückkehrkoordination,
- Eine frühzeitige Strafverfolgung zur Vermeidung unkontrollierter Rückkehr,
- Die Einbindung zivilgesellschaftlicher Deradikalisierungsnetzwerke, die sich bei der Rückführung von Frauen und Kindern bewährt haben.
Dantschke verdeutlichte abschließend: „Nicht zu handeln heißt, Risiken zu exportieren und Kontrolle aufzugeben.“
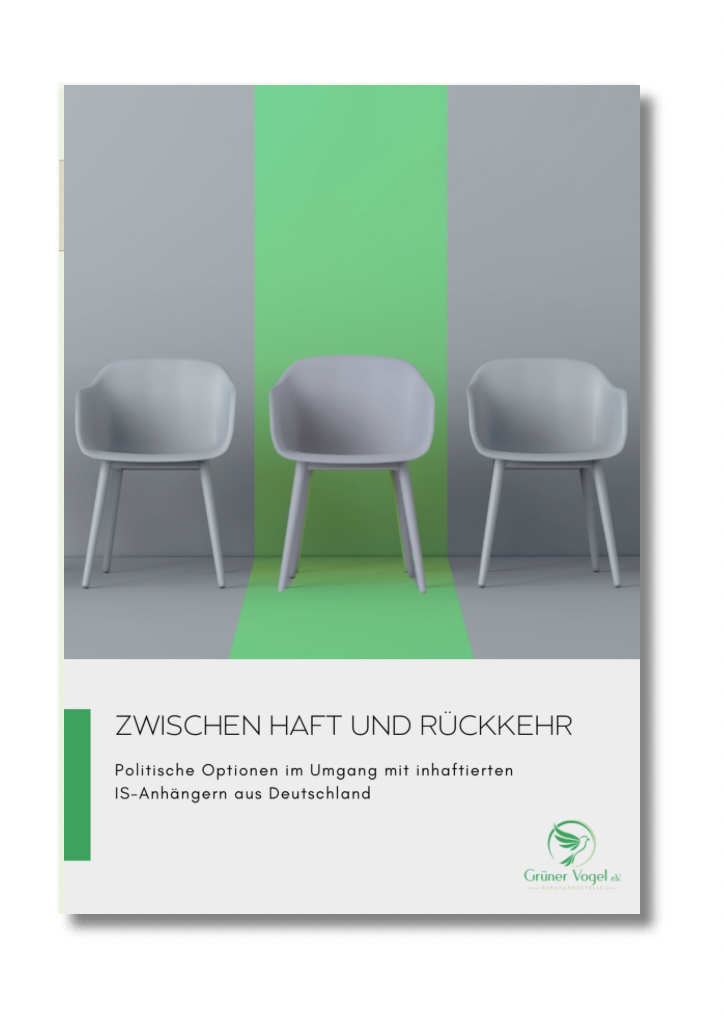
Wichmann, Fabian / Schedler, Hanno / Dantschke, Claudia (2025): Zwischen Haft und Rückkehr – Politische Optionen im Umgang mit inhaftierten IS-Anhängern aus Deutschland. Grüner Vogel e.V., Berlin. Download | Barrierearme Fassung | Download (Kurzfassung)
Analyse der sicherheitspolitischen Lage
Die Publikation und das parlamentarische Frühstück verdeutlichten, dass sich die Sicherheitsbedingungen in Nordostsyrien 2025 weiter verschlechtert haben. Der IS verfügt laut UN-Berichten über rund 2.500 aktive Kämpfer, die vor allem in Deir ez-Zor, Raqqa und Al-Hasakah operieren. Der Angriff auf das al-Sina’a-Gefängnis (Hasakah, 2022), bei dem 500 Menschen starben und hunderte IS-Kämpfer entkamen, illustriert die fragile Sicherheitslage in der Region.[4]
Die Reduktion der maßgeblich von den USA finanzierten humanitären Hilfen und die volatile US-Außenpolitik habe die kurdischen Sicherheitsstrukturen zusätzlich geschwächt. Eine militärische Eskalation zwischen der syrischen Übergangsregierung unter Ahmed al-Scharaa und anderen lokalen und regionalen Akteuren könnte jederzeit zu einem Zusammenbruch des Haftsystems führen. Das Zentralkommando der US-amerikanischen Streitkräfte hat andere Nationen darum gebeten, ihre Staatsangehörigen zurückzuholen und auch logistische Unterstützung für diesen Prozess angeboten.[5]
Sicherheitsanalytisch ergibt sich daraus:
- Langfristige Risiken entstehen weniger durch eine strukturierte Rückholung, sondern durch unkontrollierte Entlassung oder Ausbruch aus den Gefängnissen oder Lagern.
- Rechtsstaatliche Verfahren in Deutschland ermöglichen Überwachung, Gefahrenbewertung und strafrechtliche Aufarbeitung.
- Familienbasierte Reintegrationsmodelle – wie sie in der Deradikalisierungsarbeit von Grüner Vogel e.V. und anderen Projekten in Deutschland umgesetzt werden – zeigen Erfolge bei Rückkehrer*innen.
Erkenntnisgewinn durch Rückführung: Beweisbarkeit, Überprüfbarkeit, Strafverfahren
Ein zentraler sicherheitspolitischer und juristischer Vorteil einer kontrollierten Rückführung besteht in der Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu generieren, die strafrechtliche Prozesse erst ermöglichen oder substanziell untermauern. Die Überstellung von Beschuldigten nach Deutschland eröffnet konkrete Chancen:
- Verfahrensökonomie und Beweiserhebung: In Deutschland existierende forensische, kriminaltechnische und kriminalpolizeiliche Kapazitäten erlauben die systematische Identifikation, Sammlung und Prüfung von Beweismitteln, die in Nordostsyrien nicht erbracht oder verlässlich gesichert werden können.
- Überprüfbarkeit von Aussagen: Aussagen von Rückkehrern, Mitgefangenen und Zeugen lassen sich im Rahmen rechtsstaatlicher Ermittlungen gezielt verifizieren, etwa durch Abgleich mit unabhängigen Dokumentensammlungen oder mit Beweismitteln aus internationalen Ermittlungsmechanismen.
- Erweiterung strafrechtlicher Möglichkeiten: Wenn Sachverhalte überprüfbar werden, können Anklagen nicht nur wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, sondern gegebenenfalls auch wegen konkreter Taten (Gewaltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, Logistikunterstützung, Rekrutierung) erhoben werden. Dies erhöht die Chance, Verantwortliche wirksam zu verfolgen, dokumentierte Straftaten juristisch aufzuarbeiten und Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
- Prozessuale Transparenz und rechtsstaatliche Legitimation: Gerichtliche Verfahren in Deutschland bieten Angeklagten die Möglichkeit zur Verteidigung; zugleich schaffen sie eine dokumentierte, rechtsstaatlich überprüfbare Aufarbeitung, die für Opferschutz, gesellschaftliche Aufklärung und internationale Kooperation wichtig ist.
Erst die Rückholung ermöglicht strukturierte Beweissicherung, verlässliche Zeug*innenvernehmungen und die rechtliche Aufarbeitung möglicher IS-Verbrechen. Strafverfahren schaffen Transparenz, stärken die Legitimation des Rechtsstaats und dienen Opfer- wie Staatsschutz.

Das Märtyrer-Narrativ: Rolle als Treiber weiterer Radikalisierung
Ein weiterer kritischer Befund der Veranstaltung und der zugrunde liegenden Publikation ist die symbolische Aufladung inhaftierter, isolierter IS-Mitglieder zu „Märtyrern“- ein Narrativ, das in mehreren sicherheitsrelevanten Dimensionen gefährlich wirkt:
- Rekrutierungs- und Motivationsfunktion: Rechtlose Haft, fehlende Verfahren und isolierende Haftbedingungen werden von extremistischen Netzwerken als Beleg für staatliche „Ungerechtigkeit“ instrumentalisiert. Solche Narrative können potenziell zur Rekrutierung neuer Anhänger dienen, indem sie Opfermythen und Rachemotive nähren.
- Legitimationsfunktion für Gewalt: Die Verherrlichung inhaftierter Kämpfer als Märtyrer bietet ideologische Rechtfertigungen für Nachfolgegewalt und radikalisiert insbesondere junge, online-affine Zielgruppen.
- Soziale Resonanz: In Communities mit hoher Gefährdung (z. B. soziale Milieus mit vorhandenen Bindungen an extremistischen Ideologien) kann das Märtyrerbild die soziale Anerkennung von Gewaltverherrlichung stärken und Rückholverweigerung als staatliche Schwäche interpretieren.
Eine kontrollierte Rückholung und eine rechtsstaatliche Strafverfolgung eröffnen nicht nur individuelle Deradikalisierungsmaßnahmen, sondern entziehen dem Märtyrer-Narrativ den Boden. Gerichtsverfahren und transparente Aufarbeitungsprozesse setzen konkrete Gegen-Narrative zur Propaganda, indem sie Verantwortlichkeit, Öffentlichkeit und staatsseitige Handlungsfähigkeit demonstrieren. Diese Maßnahmen wirken präventiv auf die Radikalisierungsdynamik und schwächen diese auf längere Sicht strategisch ab.
Schlussbemerkung
Das parlamentarische Frühstück zeigte auf, dass Nichthandeln sicherheitspolitisch und humanitär erhebliche Risiken birgt. Eine kontrollierte Rückholung unter rechtsstaatlichen Bedingungen bekräftigt nicht nur humanitäre Normen, sondern ermöglicht konkrete Ermittlungs- und Beweissicherungsprozesse, die zu effektiven Strafverfahren führen. Darüber hinaus entzieht sie extremistischen Narrativen – allen voran dem Opfer-Mythos – die ideologische Grundlage, die zu weiterer Radikalisierung beiträgt. Die präsentierten Empfehlungen verbinden deshalb Strafverfolgung, Prävention und gesellschaftliche Integration zu einer kohärenten Sicherheitsstrategie.
[1] https://icct.nl/publication/islamic-state-2025-evolving-threat-facing-waning-global-response
[2] https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/report-mainz/swr-recherche-unit/IS-Todesfall-100.html
[3] https://gruenervogel.de/news/publikation-zwischen-haft-und-rueckkehr/
[4] Vgl. Fußnote 3
[5] https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/4315974/centcom-urges-nations-to-repatriate-displaced-and-detained-people-from-syria/